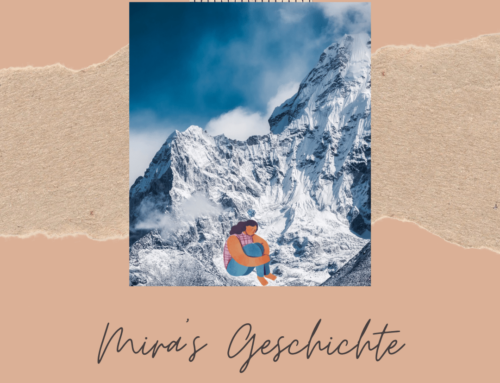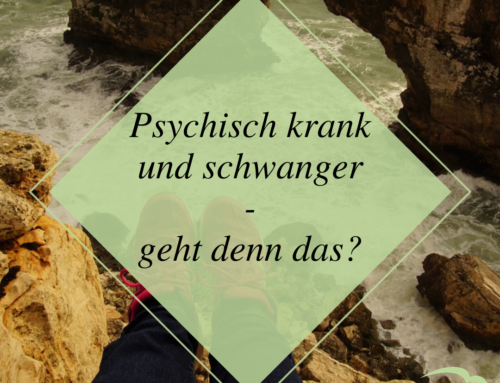Estrellita
Julia erzählt ihre Geschichte.
Ich hatte bereits zwei Kinder, einen sechsjährigen Sohn und eine dreijährige Tochter. Von ihrem Papa war ich schon seit längerer Zeit getrennt, aber wir wohnten noch zusammen, weil er noch keine eigene Wohnung gefunden hatte. Ich hatte jemanden kennen gelernt. Wir sahen uns schon seit Monaten, aber es war nichts Verbindliches. Als meine Tochter in Corona-Quarantäne war, machte ich einen Schwangerschaftstest und der war positiv, siebte Woche. Ich war geschockt. Ich ärgerte mich über mich selbst. Dazu hätte es nicht kommen dürfen. Wieso war ich so naiv gewesen? Ich hatte mir selbst etwas vorgemacht und dachte, ich wüsste, wann mein Eisprung sei. Aber der Körper ist keine Maschine und hält sich nicht an mathematische Berechnungen…
Ich hatte mit meinen Kindern und der Trennung schon so viel um die Ohren. Auch beruflich fing es gerade erst an wieder besser zu laufen. Ich hatte lange mit Depressionen zu kämpfen, hatte Klinikaufenthalte und Therapien hinter mir und meine Nerven lagen im Alltag mit meinen beiden energiegeladenen Kindern oft genug blank. Ich hatte mir die beiden Kinder gewünscht, aber ich hatte vorher nicht gewusst, dass es mir so schwer fallen würde mich auf die Mutterrolle einzustellen. Bevor ich Mutter wurde, war mir auch nicht klar gewesen, wie hochsensibel ich bin. Ich traute mir kein drittes Kind zu, dann auch noch von einem anderen Vater, und ich wäre ziemlich auf mich allein gestellt gewesen. Nur einmal die so dringende Zeit für mich zu organisieren, wäre ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Wie sollte ich die Schwangerschaft mit der gewohnten Übelkeit und ständigen Müdigkeit durchstehen, und mich gleichzeitig um meine anderen Kinder kümmern, noch dazu weiter freiberuflich arbeiten? Wie sollte ich das erste Jahr mit Stillen und wenig Schlaf meistern? Ins Auto passten auch keine drei Kindersitze und in der Dreizimmerwohnung war es auch so schon eng genug. Für all das hätte sich vielleicht eine Lösung gefunden, aber ich fühlte mich einfach komplett überfordert mit der Situation und mein Kopf sagte mir ganz klar: Nein, auf keinen Fall kannst Du das noch einmal durchstehen, und jetzt gerade erst recht nicht. Mir war klar, dass ich mich zu einem schwierigen Schritt entschließen musste. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal in dieser Situation befinden würde.
Der Erzeuger war verständnisvoll und unterstützte mich so gut er konnte, aber auch für ihn kam ein Kind nicht in Frage. Vom Verstand her war ich irgendwie erleichtert über seine Reaktion, da er mir die Entscheidung leichter machte. Ganz tief in meinem Herzen hätte ich mir allerdings insgeheim gewünscht, dass er sich freut und mir sagt, dass wir es zusammen schaffen. Wenn ich jemanden an meiner Seite gehabt hätte, der mich praktisch, finanziell und auch mental unterstützt, wäre es vielleicht etwas anderes gewesen. Aber ich hatte auch schon die Erfahrung gemacht, dass ein Kind auch trotz der Unterstützung durch den Mann eine große Herausforderung ist, und ich hatte schon zwei davon. Auch diese junge Nicht-Beziehung wäre durch ein Kind nicht einfacher geworden, denn der Alltag mit einem Baby ist für jede Art von Beziehung eine Bewährungsprobe.
Wäre die Gesellschaft und das Umfeld besser auf Kinder eingestellt, sei es mit zur Verfügung stehenden Betreuungsplätzen ab einem frühen Alter, einer Großfamilie, mit der man sich gut versteht, und die mit anpackt, dann wäre es vielleicht einfacher.
Mein Problem-Lösungsmodus hatte komplett übernommen, ich vereinbarte die nötigen Termine, regelte die Kostenübernahme mit der Krankenkasse, ging zu den Ärztinnen und zum Beratungsgespräch. Zwei Wochen später wollte ich zur Mutter-Kind-Kur fahren und bis dahin sollte alles erledigt sein. Ich wunderte mich, wie einfach das ganze doch irgendwie war und gleichzeitig war ich unendlich dankbar in einem Land zu leben, wo ich diese Wahl hatte. Dann hatte ich einen positiven Coronatest.
Ich wollte die OP unbedingt durchziehen, versuchte alles so zu organisieren, dass es trotzdem klappte, aber dann sah ich ein, dass ich erst mal eine Pause einlegen musste. Die Anspannung lies etwas nach. Ich sagte den Termin bei der Mutter-Kind-Kur ab, bzw. verschob ihn erst einmal auf unbestimmte Zeit. Darum würde ich mich später kümmern. Ich hatte zwei Wochen mehr Zeit mich mit der Situation auseinander zu setzen, inne zu halten, meine Gefühle überhaupt erst einmal zu spüren und auch mit dem ungeborenen Kind Kontakt aufzunehmen. Ich meditierte viel und schrieb Tagebuch, sofern das in der Quarantäne zusammen mit zwei kleinen Kindern und meinem Ex möglich war. Die Zeit war sehr anstrengend, denn gleichzeitig Corona zu haben und schwanger zu sein, machte mich extrem müde, und vor allem durfte es niemand erfahren. Aber es tat mir gut, diese Zeit zu haben. An meiner Entscheidung änderte das allerdings nicht.
Am Abend vor dem Eingriff begegnete ich meiner ungeborenen Tochter in einer geführten Meditation von Robert Betz, die ich mir auf CD bestellt hatte. Ich erklärte ihr meine Situation, sagte ihr, dass ich sie liebe, aber dass ich sie leider nicht bei mir haben kann, und bat sie um Verzeihung. Dann ließ ich sie gehen und sah, wie sie von einem Engel begleitet wurde. Sie sah aus, wie das unschuldige Mädchen, das ich einmal gewesen war, und ich wurde den Gedanken nicht los, dass ich mich selbst – mein inneres Kind – tötete. Aber sie war nicht allein. Es würde ihr dort, wo sie hin ging, besser gehen, als auf der Erde, versuchte ich mich zu beruhigen.
Am Tag des Eingriffs fuhr der Erzeuger mich in die Klinik. Ich war mir meiner Entscheidung sicher, schluckte die Tablette und zog mich um für den OP. Alle waren so freundlich und hilfsbereit. Ich war richtig gerührt und fühlte mich gut umsorgt in dieser schwierigen Situation. Ich habe immer noch das Bild vor meinem inneren Auge und kann das Gefühl spüren, das ich hatte, als mir die Sauerstoffmaske übergestülpt wurde, kurz bevor ich bewusstlos wurde. Ich fühlte mich, als würde ICH sterben. Als ich aufwachte zitterte und schluchzte ich, bis mir ein Beruhigungsmittel gespritzt wurde. Viel Schmerzen oder Blut hatte ich nicht.
Der Erzeuger holte mich ab, wir frühstückten zusammen und dann fuhr er mich in das Gästehaus, wo er mir ein Zimmer gemietet hatte, damit ich mich von dem Eingriff erholen konnte. Ich brauchte es allein zu sein und mich allen Gefühlen zu stellen, die kamen. Sie kamen in Wellen. Zuerst war da ganz viel Erleichterung, der Körper fühlte sich viel besser an, endlich hatte ich ihn wieder für mich allein, im „Normalzustand“. Dann war da ganz viel Trauer, Schuld, Gewissensbisse, Scham, Zorn auf Männer im Allgemeinen, die sich immer so einfach aus der Affäre ziehen konnten ohne die Konsequenzen am eigenen Körper zu spüren. Zwischendurch ließ auch das Weinen nach und ich wunderte mich, wie gut es mir doch ging. In der Zeit las ich ganz viel im Internet über das Thema, fand Homepages und Gruppen für Betroffene auf Social Media. Die Erfahrungsberichte taten mir gut. Sie gaben mir das Gefühl nicht allein damit zu sein. Denn es ist ja doch noch ein Tabu in unserer Gesellschaft. Ich rief eine Freundin an. Sie sagte mir, dass sie auch vor drei Jahren einen Abbruch hatte. Es tat so gut mit ihr zu sprechen. In den folgenden Tagen und Wochen sprach ich noch mit wenigen anderen Freundinnen darüber. Das hat mir sehr geholfen. In einer Mediation beerdigte ich meine ungeborene Tochter an einem imaginären Ort, an den ich immer wieder zurück kehren kann. Wir hatten ihr auch einen Namen gegeben.
Einen Monat später nahm ich an einem Online Seminar zu den Folgen des Eingriffs teil. Dabei wurde mir klar, wie wichtig es ist mit meinen Kindern über ihr abgetriebenes Geschwisterkind zu sprechen. Sie hatten die Schwangerschaft – ohne davon zu wissen – schon irgendwie mitbekommen. In der Zeit waren sie noch kuscheliger als sonst und kuschelten besonders viel und gern an meinem Bauch. Mein Sohn hat immer wieder gesagt: „Mama hat ein Baby im Bauch“. Es schien wie ein kindlicher Scherz, aber er hatte ja Recht damit. Als er etwas in der Art auch nach dem Abbruch noch einmal sagte, habe ich die Gelegenheit ergriffen, es ihm und seiner Schwester zu erzählen. Sie haben es erstaunlich schnell begriffen, ohne dass ich genau erklären musste, was passiert war. Mein Sohn war sehr, sehr sauer auf mich. Er hätte gern noch ein Geschwisterchen gehabt. Aber wir konnten gut drüber reden und ich habe seine Wut und seine Trauer ausgehalten. Irgendwann war es dann gut. Er hat sich sogar entschuldigt und noch viele Fragen gestellt. Wir haben dann zusammen mit dem Baby im Himmel „gesprochen.“
Meine Tochter war nicht ganz so emotional involviert. Sie hat nur gefragt, ob es Flügel hat. Und ob wir es nicht aus dem Himmel zurückholen können. Am nächsten morgen haben beide direkt nochmal etwas dazu gesagt.
Ich habe sie dann zu ihrem Papa gebracht, der inzwischen ausgezogen ist. Mein Sohn wollte ihm das erzählen. Ich habe gesagt, dass er das machen kann, wenn er unbedingt das Bedürfnis hat, aber dass es den Papa eigentlich nichts angeht, weil er nicht der Papa von dem Baby war.
Wir haben wirklich über alles gesprochen und es haben sich ganz wundervolle Gespräche daraus ergeben, die uns enger zusammenschweißen. Beim Bringen hat mein Sohn direkt zum Papa gesagt, Mama hatte ein Baby im Bauch. Aber ich bin dann direkt gegangen und weiß nicht, wie es weiter ging. Es ist aber auch in Ordnung für mich. Mir ist es wichtiger mit den Kindern offen drüber zu sprechen, als es vor allen anderen geheim zu halten. Sonst wird es sie unbewusst beeinflussen. Was ich aus der ganzen Situation gelernt habe ist: Man muss sich den Dingen und den Gefühlen stellen. Je bewusster der Umgang mit dieser Krise, desto weniger verfolgt es einen später. Verdrängen hilft nicht. Ich denke noch oft an meinen Engel im Himmel, der auf uns alle aufpasst, und auch meine Kinder fragen noch manchmal nach ihrer kleinen Schwester.
Zum aktuellen Zeitpunkt glaube ich, dass es die richtige Entscheidung für mich und meine Familie war.

© Canva free design
Eine Liebe zerronnen, die große Liebe gewonnen
Janina war 32 und seit einem Jahr von ihrem Mann getrennt. Kinder waren ihr nie vergönnt gewesen, und mit Hilfe einer Therapie hatte sie sich damit abgefunden. Das ist ihr Bericht:
„Mitte Dezember war ich gerade frisch zu meinem damaligen Freund gezogen. Ich habe dafür Job, Wohnung und Möbel aufgegeben. Am 23.12. war ich zu meinen Eltern gefahren, um Weihnachten mit ihnen zu verbringen. Am Heiligabend wollte ich meine Mutti zum Frühstück wecken, doch sie wachte nicht mehr auf. Ich organisierte mit meiner Familie die Beerdigung.
Ich musste mich in der Zeit drei Tage lang übergeben und war nach einiger Zeit sicher, dass das nicht mehr von der Trauer kommen konnte. Ich kaufte also einen Schwangerschaftstest und kaum angewendet, blitzen mich zwei Striche an.
Ich fuhr nach Hause und erzählte es meinem Freund. Er schaute mich eiskalt an und entgegnete: „Entweder du treibst ab, oder du kannst aus der gemeinsamen Wohnung abhauen!“ Für mich brach eine Welt zusammen: vor drei Tagen meine Mutter verloren, schwanger und einen Freund mit einem solch harten Verhalten.
Zwischen den Feiertagen war keine Praxis offen, sodass ich in das nächstgelegene Krankenhaus ging und um einen Gynäkologen bat, der die Schwangerschaft bestätigen sollte und mich eventuell wegen eines Abbruchs beraten konnte. Sie schickten mich anteilnahmslos weg, obwohl jemand da war.
Ich rief bei Donum Vitae an und bekam einen Beratungstermin im neuen Jahr sowie eine Praxis in einer anderen Stadt, die mich untersuchen wollte.
Bei der Untersuchung war ich in der neunten Woche, und als ich ihn auf dem Ultraschall sah, brach ich in Tränen aus, und meine Entscheidung war gefällt: Ich konnte es nicht übers Herz bringen, und auch das Beratungsgespräch bestärkte mich in meiner Meinung.
Nur wie umsetzen? Das Amt wollte mir nicht helfen, da ja der Kindsvater für mich zuständig war. Ich weinte mich durch die Nächte und wiederholte immer mein Mantra, während ich meinen Bauch streichelte: „Wir schaffen das schon, Mama liebt dich!“
Meine beste Freundin in meiner 400 km entfernten Heimat erzählte mir, dass ihr WG-Mitbewohner ausziehe und ich sein Zimmer haben könne. So zog ich im vierten Monat mit nichts als nur Klamotten und Deko im Gepäck zu meiner Freundin. Auch mein Auto musste ich weggeben. Von dem Kindsvater persönlich hörte ich nie wieder etwas, nach wie vor entzieht er sich dem Jugendamt.
Am letzten Abend vor dem Umzug lernte ich meinen jetzigen Freund kennen. Er unterstützt mich bis heute sehr.
Als ich zu seinem Geburtstag im Mai mit dem Zug nach Osnabrück reiste, merkte ich in der Nacht, dass etwas nicht stimmt: Ich hatte Durchfall und Krämpfe. Da das Krankenhaus um die Ecke war, sind wir um 4 Uhr morgens in die Notaufnahme gefahren. Ich hatte in der 28. SSW Wehen, und der Gebärmutterhals war nur noch bei 1,2 cm. Wieder brach meine Welt zusammen. Ich kam auf Station an die Tokolyse. Erst hieß es, ich bräuchte nur einige Stunden dortbleiben, dann 48 Stunden, und zum Schluss war ich ganze vier Wochen im Krankenhaus. Ich durfte nur zur Toilette aufstehen und zum CTG. Vier Mal wollte er in den vier Wochen raus, und da ich in der letzten Woche trotz Tokolyse alle zehn Minuten Wehen hatte, ließ ich sie abstellen.
Nach 26 Stunden Wehen erblickte meine große Liebe, mein kleiner Yannik, bei 32+6 das Licht der Welt. Klein und zerbrechlich kam er auf die Neonatologie. Drei quälende Wochen musste er dortbleiben. Jeden Abend, wenn ich ihn verlassen musste, weinte ich, dass er noch nicht bei mir sein kann. Dann endlich durfte er raus, und wir kehrten nach Hause zurück.
Es gab sehr viele Probleme mit den Ämtern, da vom Kindsvater keine Vaterschaftsanerkennung vorlag. Weil er aber noch in der Ehe geboren war, mussten wir die Vaterschaft gerichtlich aberkennen lassen. Um jeden Cent musste ich für ihn kämpfen, aber es gelang mit Hilfe von gemeinnützigen Organisationen. Ich kämpfte mich für mein Baby durch alle Widrigkeiten – oft am Rande eines Nervenzusammenbruchs, doch mit einer Stärke, die ich von mir nicht kannte.
Dieses Jahr im April zog ich in meine eigene kleine Wohnung in Osnabrück, um meinem Freund näher zu sein. Hier haben wir liebe Freunde kennengelernt, gehen mittwochs zum Eltern-Café und erkunden die Stadt.
Ich habe lange gebraucht, um damit klarzukommen, was ich alles verloren habe. Gerade um meine kinderlose Spontaneität – wie Partys, Reisen und Freizeit – habe ich lange getrauert, ebenso wie um das Geld, das ich vorher verdient habe und für meinen Spaß nutzen konnte. Jetzt habe ich das alles nicht mehr, doch dafür habe ich eine bedingungslose große Liebe gefunden und lebe jetzt ein anderes, aber nicht minder schönes Leben. Ich musste mich nur darauf einlassen, denn die letzten 15 Monate mit Yannik waren die liebevollsten meines Lebens.“
(Janina, September 2019)
Herzenskinder
In meiner Geschichte geht es um Angst und Trauer, um Unglück und Verlust, um Glück und um Liebe.
Im Jahr 2004 war ich in einer sehr toxischen und von emotionaler Abhängigkeit geprägten Beziehung. Mein damaliger Freund war gerade aus einem Auslandseinsatz zurückgekommen und hatte neben Dengue-Fieber auch eine psychische Krankheit mitgebracht. Wir haben oft getrunken und einmal nicht richtig aufgepasst – und dann war ich 22 und schwanger und er psychisch krank (Angststörung, Panikattacken, Borderline-Persönlichkeitsstörung).
Rückblickend empfinde ich mein Verhalten von damals als leichtsinnig. Ich war sofort sicher, dass ich in der Situation kein Kind will: Ich hatte meine Ausbildung gerade beendet spürte auch irgendwie, dass mein damaliger Freund zu dem Zeitpunkt keine Kraft gehabt hätte, Vater zu sein. Er wollte sich vor allem um sich kümmern, und ich wollte arbeiten, leben, die Welt entdecken usw. Mein Freund wollte das Kind, stand aber trotzdem hinter meiner Entscheidung.
Ich habe das alles durchgezogen: Beratung. Klinik und dann, obwohl ich so sicher war, dass es die beste und richtige Entscheidung war, ging es mir danach schlecht. Ich bin psychisch in ein totales Loch gefallen und habe es so bereut.
Mein Freund und ich legten es ein Jahr später auf eine Schwangerschaft an, doch es hat nicht mehr geklappt. Irgendwann ging diese Beziehung auseinander. Ich bin heute rational noch immer sicher, dass es in dieser Situation damals richtig war, den Abbruch durchführen zu lassen. Aber die Trauer um „mein Baby“ hielt trotzdem sehr lange an. In der Zeit der Trauer war ich nie sicher, ob ich das Recht habe, um mein Kind zu trauern und es zu vermissen. Schließlich hatte ich mich selbst gegen das Kind entschieden und hatte somit das Gefühl, es stehe mir nicht zu, zu trauern.
Ich habe keine Chance gehabt, mich zu verabschieden oder mich mit dem Verlust auseinanderzusetzen. Wenn ich vor der Trennung versuchte, mit meinem Freund zu reden, wurde er immer wütend und sagte, dass er das Kind ja hatte behalten wollen. So empfand ich immer die doppelte Schuld und gestand mir noch weniger Rechte zu, traurig zu sein.
Ab und an versuchte ich, mit Freundinnen darüber zu reden, doch das brachte nichts, weil jemand, der die Erfahrung nicht machen musste, das Ganze nicht verstehen kann. Als ich 2007 anfing zu studieren, kochte alles noch einmal hoch: Wir hatten ein paar sehr christliche Menschen in unserer Uni, die auch in vielen meiner Seminare waren. Weil ich Sozialarbeit studiert habe, wurde natürlich die Selbstbestimmung der Frau und somit auch Abtreibung immer mal wieder Thema in einigen Diskussionen. Hier schlug ich mich immer auf die Seit der Abtreibungsbefürworter, obwohl ich dieses Wort so verabscheue, weil ich selber erfahren musste, wie weh so eine Abtreibung tut, und ich sicher bin, dass die wenigsten Frauen so eine Entscheidung leichtfertig treffen. Nicht so wie ich. Ich war mir der emotionalen Konsequenzen nicht bewusst gewesen. Deshalb verteidigte ich die Abtreibung gegen die „Hardliner“. Die Diskussionen machten mir immer sehr zu schaffen.
Natürlich bin ich für Abtreibung. Ich finde es sehr wichtig, dass eine Frau das Recht am eigenen Körper hat. Niemand außer mir darf über meinen Körper entscheiden! Und trotzdem spürte ich eben auch mit Nachdruck, wie sehr man leidet, wenn man sich gegen sein Kind entscheidet, und DAS sagt einem vorher niemand, auch nicht die Beratungsstelle oder der Arzt.
Eigentlich hörte der Schmerz um den Verlust meines Babys erst auf, als ich mit meiner Tochter dann sechs Jahre nach der Abtreibung wieder schwanger war.
Das war auch ungeplant. Quasi ein Kondom-Unfall im Auslandssemester. Aber nochmal abtreiben wäre niemals denkbar gewesen, auch wenn der Vater das angesprochen hatte (Tradition, Religion, Familie usw.). Ich hatte ihm damals gesagt, dass er das mit mir durchziehen kann – oder eben nicht. Er kam dann nach Deutschland, als die Kleine drei Monate alt war.
Nach zwei Jahren haben wir uns getrennt, weil es eben doch nichts bringt, sich zu verbiegen, weil man ein Kind zusammen hat. Es war alles schwer, aber alles machbar und meine Tochter ist so ein wundersüßes Kind. Glücklich, lebendig, hilfsbereit und inzwischen acht Jahre alt. Meine Tochter hat mit ihrem Vater regelmäßigen und sehr liebevollen Kontakt. Er bereut keine Sekunde, dass es sie gibt, auch wenn das für ihn eine wahnsinnige Umstellung bedeutet hatte.
Und ich? 2014 habe ich einen Mann kennengelernt, mit dem ich dann auch bald zusammengezogen bin. 2015 hatte ich eine „Missed Abortion“ in der 15.SSW – da kam dann alles aus 2004 wieder hoch. Doch da habe ich mir erlaubt zu trauern, und zwar nicht nur um das verlorene Baby, sondern das erste Mal auch wirklich um mein anderes Sternenkind.
Vor 3 Jahren kam dann mein Sohn zur Welt. Er ist behindert und wir (mein Mann und ich) erhielten die Diagnosen „Offener Rücken, Wasserkopf, inkomplette Querschnittslähmung “ in der 22. Schwangerschaftswoche. Uns wurde zu einem Spätabbruch geraten. Uns wurde auch gesagt, dass wir bei der Diagnose noch bis zum Einsetzen der Wehen „abbrechen“ können. Uns wurde auch erklärt, wie so ein Spätabbruch funktioniert: mit einer Kaliumspritze durch die Bauchdecke der Mutter ins Herz des Kindes. Bei Eintreten des Herzstillstandes werden dann die Wehen eingeleitet.
Wir wollten das gar nicht hören, denn wir haben nicht eine Sekunde daran gedacht, die Schwangerschaft zu beenden. Wir haben geweint und waren hilflos. Wir hatten Angst und waren wütend. Wir haben gezittert und gehofft, und wir haben entschieden! Wir haben uns für unseren Sohn entschieden und für alles, was er mit sich bringt. Die Prognosen gingen weit: geminderte Intelligenz, Blasen- und Darminkontinenz, ein Leben im Rollstuhl, Pflegbedürftigkeit, Krankenhausaufenthalte und viele Operationen.
Es hat sich gezeigt, dass der Outcome gar nicht so schlecht ist. Einiges traf zu, anderes nicht. Unser Sohn kann mit Schienen laufen und hat für längere Wege einen superschicken Rollstuhl. Er hatte drei Operationen, davon eine aufgrund des Wasserkopfes und eine wegen des Rückens (diese Operation wurde sogar noch vor der Geburt durchgeführt).
Er hat eine neurogene Blasen- und Darmstörung, die wir aber bis jetzt gut im Griff haben, indem wir ihn katheterisieren und ihm Einläufe machen. Natürlich haben wir viele Termine und unser Sohn ist zeitintensiver als ein gesundes Kind. Aber er ist so ein sonniges und zauberhaftes Wesen, und ich bin so unendlich dankbar für ihn. Jetzt geht er auch in eine Kita, wo er als Integrationskind extra Förderung bekommt, er findet Freunde, geht turnen und reiten und hat so viel Spaß am Leben.
2004 habe ich gedacht, mein Leben geht zu Ende. Ich war sicher, dieser Schmerz hört niemals auf. Ich weiß aber auch, dass die Trauer nicht nur die Trauer um das Baby war. Ich habe auch um meine Beziehung getrauert, um die Psyche meines Freundes, darum, dass mir die Beziehung nicht gutgetan hat und ich nicht loslassen konnte. Es ging einfach viel zu viel ums Loslassen in dieser Zeit.
Dennoch – wäre ich noch einmal in derselben Situation, hätte ich mich trotz allem für das Kind entschieden, vor allem, weil ich durch meinen Sohn gelernt habe, wie viel Kraft in mir steckt und was ich alles schaffen kann.
Heute bin ich glücklich mit meiner verrückten Patchworkfamilie. Ich liebe meine Kinder unendlich und denke, dass immer eine Entscheidung zur nächsten führt. Inzwischen habe ich auch mit der Abtreibung abgeschlossen und wenn jemand fragt, dann habe ich zwei Kinder an der Hand und zwei Kinder im Herzen.
(Sarina)
Mein Name ist Lisa. Ich bin 37 Jahre alt, Mama von drei wunderbaren Kindern und seit 22 Jahren mit meinem Mann zusammen.
Die beiden ersten Kinder bekam ich sehr jung: Ich war 18 und 20 Jahre, als sie zur Welt kamen. Von meiner Familie konnte ich schon damals keine große Hilfe erwarten – im Gegenteil: Sätze wie: „Ihr schafft das sowieso nicht!“, waren allgegenwärtig. Doch wir schafften es, und mit 26/27 entbrannte ein neuer Kinderwunsch. Dass es so schwer werden würde, diesen zu erfüllen, hätten wir nicht gedacht. Nach Jahren ohne Erfolg suchten wir uns Hilfe in einem Kinderwunschzentrum. Wir machten unzählige erfolglose Hormonbehandlungen, bis wir mit Inseminationen begannen, die nach vier Versuchen zum Erfolg führten. Wir waren überglücklich, als ich den positiven Test in der Hand hielt. Alles lief zunächst perfekt, abgesehen von dieser schrecklichen Übelkeit. Schnell gesellte sich das massive Erbrechen dazu (Hyperemesis – in einer ganz schlimmen Form). Ich wog schon vorher sehr wenig. Leider musste ich mehrfach in die Klinik zur Infusionstherapie. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Mittlerweile wog ich nur noch 38 Kilo. In der 24. SSW hatte ich abends starke Bauchschmerzen, und ich bat meinen Mann, mich in die Klinik zu bringen. Es waren Wehen, die sich auf die Zervix auswirkten. In der Klinik ging alles ganz schnell: Ich wurde in den Kreißsaal geschoben, und zig Menschen und Ärzte redeten und erklärten. Der einzige Satz, der hängenblieb: „Wenn die Wehenhemmer nicht anschlagen, wird ihr kleiner Sohn zur Welt kommen.“ Er wog geschätzte 800 Gramm. Da gab es kein Halten mehr, und wir brachen in Tränen aus. Der Wehenhemmer wurde angeschlossen, und ich lag zugedröhnt auf dem Kreißsaal-Bett. Die Wehen hörten auf, und ich bekam die erste Lungenreife-Spritze. Das Krankenhaus wurde mein neues Zuhause, ich durfte nur liegen. Erst in der 34. SSW konnte ich endlich heim. In der 36 SSW. kam unser Sohn zur Welt, er war gesund, klein und leicht.
Ich wollte immer viele Kinder haben. In einem unbeschwerten Urlaub wurde ich überraschend schwanger. Dabei hatte es all die Jahre nicht funktioniert! Ich freute mich und rief meinen Mann in der Mittagspause an. Er war baff und wollte später in Ruhe darüber reden. Abends im Wohnzimmer schaute er mich an und sagte: „Wir können dieses Baby nicht bekommen!“ Es war ein Schlag ins Gesicht, und mein Herz zerbrach in diesem Moment in tausend Teile. Er war überzeugt, dass wir es nicht schaffen und unsere Familie daran zerbrechen würde, wenn wir noch einmal derartige Ängste ausstehen müssten wie damals mit unserem kleinen Sohn. Ich fing an zu weinen und verstand die Welt nicht mehr.
Am nächsten Tag musste ich mit Verdacht auf eine Eileiterschwangerschaft in die Klinik, wo ich stationär aufgenommen wurde. Ich schrieb viel mit meinem Mann, der nach wie vor der Auffassung war, dass wir es nicht verkraften würden, wenn wir das Baby verlieren. Ab diesem Zeitpunkt machten sich bei mir Ängste breit – Ängste, Verzweiflung und Wut.
Mit einer intakten Schwangerschaft wurde ich aus der Klinik entlassen. Ich war wie in einem Tunnel gefangen, jegliche Gefühle zu meinem Baby hatte ich „abgestellt“. So wurde ich beim Frauenarzt vorstellig und sprach das aus, was für mich immer undenkbar gewesen war: Ich forderte einen Schwangerschaftsabbruch und ließ mir alles erklären. Zu dem Beratungsgespräch in der Konfliktberatungsstelle begleitete mich mein Mann. Hilfsangebote gab es keine – im Gegenteil: Die Beraterin schickte mich in den Tunnel voller Angst zurück. Binnen 5 Minuten hatte ich diesen Schein in der Hand.
Zwischendurch gab es einen Moment, in dem ich kurz aus dem Tunnel entkam und ich dachte: „Ich schaffe es mit meinem Mann oder auch ohne ihn!“ Doch meine Schwiegermutter erstickte diesen kurzen Hoffnungsschimmer im Keim, indem sie mir vorhielt, wie schlimm die Zeit der letzten Schwangerschaft war. Wir sollten das Glück nicht noch einmal herausfordern. Was wäre, wenn ich es körperlich nicht schaffen würde usw.? Jegliche Gefühle, die neu entflammt waren, stellte ich erneut ab. Ich funktionierte nur noch, und ich wollte den Abbruch so schnell es geht hinter mich bringen.
Bei der Voruntersuchung für den Abbruch erklärte mir der Arzt alles, er war sehr lieb und drehte beim Ultraschall den Bildschirm von mir weg. Heute wünschte ich mir, er hätte ihn zu mir gedreht…
Am Tag des Eingriffs saß ich mit meinem Mann morgens im Wohnzimmer und das einzige, was ich mir wünschte, war, dass er mir hilft, dass er mir sagt: „Schatz, wir schaffen das!“ Als ich die Tabletten zur Vorbereitung des Eingriffs nahm, wusste ich: Jetzt gibt es kein Zurück mehr!
Sie brachten mich in einen Raum, wo schon zwei Damen lagen und gerade langsam aus der Narkose erwachten.
Ich sollte mich untenrum frei machen. Als die Narkoseärztin kam, brachen alle Dämme. Ich weinte schrecklich und sagte: „Ich möchte das alles nicht!“ Am liebsten wäre ich, nackt wie ich war, aus der Praxis rausgerannt. Denn da war sie, die Liebe zu meinem Baby. Sie war mit voller Wucht zurückgekehrt: Was zum Teufel tue ich da gerade?
Doch es gab keinen Weg mehr zurück, es war zu spät.
Man führte mich in den OP und schnallte meine Füße fest. Die Narkoseärztin versprach, auf mich aufzupassen und fragte mich, wo ich am liebsten hinreisen würde. Die andere Schwester streichelte meine Hand. Und ich weinte und weinte und schluchzte und wünschte, ich läge am Strand.
Beim Aufwachen fühlte ich zunächst Erleichterung: Die große Last war weg. Mein Mann wartete draußen und ich bestätigte, es sei die richtige Entscheidung gewesen. Mir ging es körperlich super, und ich dachte, es wäre alles so, wie es mal war.
Bis ich zwei Tage später vor dem Spiegel stand: Das war nicht mehr ich! Ich weinte bitterlich. Was ich fühlte, ist unbeschreiblich: Ich hatte mein eigenes Kind ermordet!
Seitdem veränderte sich alles: Ich weinte mich jede Nacht in den Schlaf, konnte mich nicht mehr spüren. Irgendwann kam ich an den Punkt, an dem ich dachte, es sei besser, tot zu sein. Ich wollte bei meinem Kind sein. Ich redete viel mit meinem Mann, der dieses Gefühl nicht verstehen konnte. Wie auch? Er hatte unser Kind nicht umgebracht – er spürte diese Leere nicht.
Ich suchte mir Hilfe und noch heute – zwei Jahre später – gehe ich zur Therapie und weine mich oft in den Schlaf. Ich bete und rede jeden Abend mit meinem Kind und bitte es um Verzeihung. Ich wünschte mir, ich hätte das alles nie getan.
(Lisa, 37)
Das war nicht ich!
Ich hatte in der 11. Woche einen Schwangerschaftsabbruch.
In der 5. Woche erfuhr ich, dass ich schwanger bin. Ich weiß noch, dass ich von der Schwangerschaft nichts gemerkt habe. Zu der Zeit feierte ich jeden Tag Karneval, war zwischendurch krank und machte im Büro Überstunden ohne Ende. Meine Periode blieb aus, und ich schob es auf die eben genannten Faktoren und glaubte, dass sie eben etwas später eintrifft. Mein Freund war nach einigen Tagen der Auffassung, dass wir mal einen Test machen sollten. Ich habe ihn noch angemeckert, dass er aufhören solle, so eine Panik zu schieben, dass ich nicht schwanger sei! Doch der Test war positiv! Mir fiel alles aus dem Gesicht. Wir wechselten uns ab mit Weinen, Lachen, Verzweiflung und Freude – es war eine Mischung aus allem. Es war klar, dass wir das Kind bekommen.
Zwei Tage später überkam mich eine Panikattacke. Zur Begründung: Ich bin seit zehn Jahren alleinerziehende Mutter eines Jungen und mit meinem jetzigen Partner erst seit einem Jahr zusammen. Vor ihm führte ich sechs Jahre lang eine Beziehung mit einem Narzissten, der mir das Leben zur Hölle machte. Es hat drei Jahre gedauert, bis ich mich ansatzweise davon erholt habe. Mit meinem Sohn, den ich mit 21 bekam, als ich weder einen Schulabschluss noch eine Ausbildung hatte, habe ich mich immer durchs Leben gekämpft. Ich habe es geschafft, mein Abi zu absolvieren, habe zwei Ausbildungen gemacht und mich Stück für Stück mit Kind und ohne Unterstützung von Freunden und Familie hochgearbeitet. Und jetzt, da mein Leben gerade ruhiger wurde und ich mich angekommen fühlte, erfuhr ich kurz vor der Schwangerschaft, dass mein neuer Partner mich komplett belogen hat: Er hat sich erfolgreicher dargestellt, als er eigentlich war – Ausbildung, Arbeitsplatz, all das entsprach nicht der Realität! Er hatte mich schamlos belogen, um mich zu bekommen. Es war ein Schock für mich, und eine Welt brach zusammen. Und nun: schwanger!
In meinem Kopf wüteten die Gedanken, dass ich nun wieder bei null anfangen müsste: wieder alleinerziehend, doch diesmal von zwei Kindern mit riesigem Altersunterschied. Meine berufliche Karriere unterbrechen, Elternzeit und wieder finanziell knapsen, die Wohnung zu klein, eine größere undenkbar. Und meine Freiheit – gerade hatte ich begonnen, wieder ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben, und jetzt das! Die Gedanken überschlugen sich, und ich konnte mit dem Weinen nicht mehr aufhören. An diesem Tag habe ich mich verändert. Für mich war nun klar: Das Baby muss weg! Und zwar so schnell, wie es nur irgend geht. Ich habe sofort bei Pro Familia angerufen, bekam am Montag den Beratungsschein, war Dienstag bereits in der Praxis zum Vorgespräch und organisierte mir für Freitag den Termin zum operativen Abbruch.
Mittwoch habe ich meinen Freund nur noch angeschrien und rausgeschmissen. Ich gab ihm die Schuld dafür, dass ich das Kind nicht bekommen konnte, weil ich ihm nicht mehr vertrauen oder mich auf ihn verlassen konnte und deshalb eine solche Entscheidung treffen musste. Einen Tag später flehte er mich an, das Kind nicht abzutreiben. Dies gab mir die Hoffnung, es vielleicht doch irgendwie zu schaffen, sodass ich den Termin um eine Woche verschob. Beim nächsten Gyn-Termin sah ich das Herz des Babys schlagen, und ich empfand so etwas wie verhaltene Freude. Ich bin mit meinem Freund in Babyläden gefahren und habe versucht, mich an den Gedanken zu gewöhnen, noch einmal Mutter zu werden. Doch einige Tage später wendete sich das Blatt erneut: Ich musste mich permanent übergeben, konnte nicht mehr arbeiten und war körperlich fix und fertig. Ich aß nichts mehr und rauchte ohne Ende, so verzweifelt fühlte ich mich. Dieser Zustand war wie die Hölle! Doch obwohl mein Freund und ich stritten wie verrückt, sagte ich auch den zweiten Termin ab.
Ich kämpfte mich zurück: Ich hörte mit dem Rauchen auf, begann wieder zu Essen, organisierte eine Hebamme und kümmerte mich um eine neue Wohnung. Doch am Ende der 9. Woche überkam mich erneut eine Welle der Panik. Obwohl die Praxis schon genervt von meinem Hin und Her war, gab sie mir einen dritten Termin für den Abbruch. Wieder sagte ich ab. Ich hatte nur noch den Gedanken im Kopf, mich in mein Auto zu setzen und gegen den nächsten Baum zu fahren. Ich war psychisch und körperlich komplett am Ende.
Und dann schien es mir, als hätte jemand mir meine Gefühle weggenommen, und alles in mir wurde eiskalt. So kalt, dass ich mich selbst nicht mehr erkannte. Mir war alles egal. Ich machte den 4. Termin in der Klink aus, den ich vor meinem Freund geheim hielt. Ich wollte mich nicht mehr beeinflussen lassen, sondern für mich eine Entscheidung treffen und durchziehen. Alles in mir wehrte sich gegen die Schwangerschaft. Ich hatte keine Gefühle, keine Bindung, nichts war mehr da.
Unter Tränen kam ich in den OP-Bereich. Es war furchtbar, der ganze Ablauf traumatisch: Ich musste in den Raum, auf den Stuhl und habe alles gesehen. Ich wurde an den Armen und Beinen festgebunden, und schon war die Nadel im Arm und ich weg. Auf dem Stuhl liegend erwachte ich aus der Narkose. Ich hatte höllische Schmerzen. Zu Hause hatte ich einen Nervenzusammenbruch und konnte nur noch weinen. Ich hatte Panik davor, auf Toilette zu gehen und habe mich vor mir selbst nur noch geekelt. Am nächsten Tag fuhr ich 650 km nach München zu einer Freundin, weil ich es hier nicht mehr ertragen konnte. Dort war ich zwei Tage später in der Notaufnahme, weil ich vor Schmerzen fast ohnmächtig geworden war. Ich hatte Wehen und Sturzblutungen. Es wurde ein Ultraschall gemacht und festgestellt, dass bis auf das Baby alles noch in mir war. Diagnose: Abortus incompletus nach Saugcurretage. Ich war am Ende, und der Alptraum ging weiter…
Ich bekam Cytotec, musste am nächsten Tag zurück in meine Heimat und dort wieder ins Krankenhaus. Eine Woche jeden Tag zum Ultraschall und jeden Tag Cytotec. Immer die Angst, doch noch eine Ausschabung zu bekommen, was die Ärzte versuchten zu vermeiden, um Gebärmutter und Muttermund zu schützen. Gleichzeitig ein Wettlauf gegen die Zeit, da die Entzündungswerte stiegen und auch somit auch die Gefahr für eine Gebärmutterentzündung. Es war das Schlimmste, was ich je in meinem Leben erleben musste, und ich habe seitdem jede Nacht Alpträume und kann keine Schwangere oder Babys sehen.
Jetzt, da der ganze Spuk vorbei ist und auch die Hormone „weg“ sind, fühle ich mich so unglaublich leer. Ich bin richtig depressiv geworden, und mir kommen ständig die Tränen. Ich zweifle oft an meiner Entscheidung. Auf der einen Seite bin ich erleichtert, weil dieses Hin und Her ein Ende hat, auf der anderen Seite hätte ich am liebsten JETZT eine stabile Beziehung und wäre wieder schwanger. Das klingt verrückt, aber so sieht es in mir aus.
Ein Teil in mir hasst mich dafür, was ich getan habe. Ich blicke auf die Zeit zurück und frage mich, wie ich so kalt sein konnte. Das war nicht ich in dieser Zeit, so kenne ich mich nicht. Ich vermute, dass ich unter einer Schwangerschaftsdepressionen litt, und zwar ziemlich schlimm. Jetzt ist es zu spät, und ich bereue es zutiefst. Ich weiß nicht, wie ich damit leben soll. Ich geißle mich selbst, indem ich mir Abtreibungsvideos oder Bilder im Internet ansehe, wie mein Kind wohl aktuell ausgesehen hätte. Hätte ich diese nur vor dem Eingriff gesehen!
Ich finde im Nachhinein, dass der Abbruch zu sehr verharmlost wird. Immer wieder wurde mir gesagt: „Das ist schnell gemacht, alles Routine, nach 10 Minuten sind Sie wieder fit.“
Überlegt euch wirklich gut, ob eine Abtreibung der richtige Weg für euch ist. Viel Kraft für euch, die ihr vielleicht in einer ähnlichen Situation steckt.
Saskia, zwei Wochen nach dem Abbruch.
Beruflich voll durchstarten vs. wieder schwanger – und nun?
Ich bin Mama eines einjährigen Sohnes und frisch verheiratet. Mein Plan war, nach einem Jahr Elternzeit wieder voll arbeiten zu gehen, weil ich dies sehr gern wollte, aber aus finanziellen Gründen auch musste. Als meine Tage ausblieben, habe ich mir zunächst nicht viel dabei gedacht. Man sagt ja, es brauche ein Jahr, bis sich die Hormone wieder umgestellt haben, sodass ich dachte, dies sei nur wieder mein alter unregelmäßiger Zyklus. Nach einiger Zeit wurde ich dann aber doch unruhig und sprach mit meinem Mann, der mir einen Test mitbrachte. Ohne Zweifel – ich war tatsächlich wieder schwanger. Mein Mann fand die Idee, ein zweites Kind zu bekommen, super – für ihn würde sich ja auch nichts ändern. Doch für mich brach eine Welt zusammen:
A) wollte ich gar nicht unbedingt ein zweites Kind,
B) sind wir recht knapp bei Kasse, und ich sah schon eine Vielfalt an Problemen auf mich zurollen,
C) hatte ich mir jahrelang so vieles aufgebaut, um in meinem Traumjob durchstarten zu können, und das ging vor meinem inneren Auge alles den Bach runter,
D) lief es in meiner Beziehung auch nicht rund.
Kurzum: Alles Sch….
Ich weinte hysterisch, und mein Mann war mir dabei keine Hilfe – auch heute ist er das noch nicht. Er ist ein feiner Mensch, doch nehme ich ihn als ein wenig überfordert mit dem Leben wahr (vom Gefühl her verhält er sich also manchmal schon wie ein zweites Kind).
Sofort dachte ich an einen Abbruch der Schwangerschaft und befragte Google, sodass ich auf der Seite von abtreibung.de landete. Mit Silvia fand ich jemanden, dem ich mich anvertrauen und mein Leid klagen konnte.
Zurück ins Berufsleben – und jetzt wieder schwanger – was tun?
Eine Woche nach dem Test hatte ich einen Termin beim Frauenarzt, zu dem mich mein Mann begleitete. Es war genau am 1. Geburtstag unseres Sohnes. Ich war so überhaupt nicht in Stimmung. Die Ärztin bestätigte die Schwangerschaft, und bei mir brachen alle Dämme. Ich hatte vorher erwähnt, dass ein Abbruch in Frage kommt und war dankbar, dass sie sehr liebevoll mit dem Thema umging. Sie gab mir eine Woche Bedenkzeit.
Diese Woche brauchte ich auch! Nicht, weil die Entscheidung nicht schon längst gefallen war, sondern weil ich die Zeit brauchte, um mir selbst Mut für meine Entscheidung zu machen…
Denn in dem Moment, als ich den Herzschlag des Babys sah, konnte ich nicht mehr anders. Ich bin ein recht sachlicher Mensch, aber die Verantwortung dafür zu übernehmen, diesen sichtbaren Herzschlag beenden zu lassen, war außerhalb meiner emotionalen Möglichkeiten. Ich könnte jetzt schon wieder weinen, wenn ich daran denke.
Gesagt, getan! Die Entscheidung für das Kind war getroffen. Doch wie würde es jetzt weitergehen? Dank Silvia hatte ich eine Idee, wo ich mir Hilfe suchen konnte und nahm entsprechende Beratungsgespräche in Anspruch. Das gab mir viel Sicherheit.
Jetzt bin ich in der 15. Woche und kann realistisch einschätzen, was auf mich zukommt. Ich werde es nehmen, wie es kommt. Wie heißt es so schön – man wächst mit seinen Aufgaben.
Ob ich die Beziehung zu meinem Mann aufrechterhalten kann, weiß ich noch nicht genau, aber ich weiß, dass ich es schaffen kann. Wie? Keine Ahnung – ich boxe mich einfach durch. Wird es holprig? Ich befürchte ja. Ist es das wert? Auf jeden Fall. Das Schicksal hält so einiges für uns parat, wir entscheiden nur, wie wir damit umgehen wollen.
(Claudia im Dezember 2017)
Bilderbuchfamilie mit Traummann vs. ungewollte Schwangerschaft
Lisa war nie der Typ, der mal unbedingt Kinder haben wollte. Zudem erhielt sie mit 18 Jahren die Auskunft von ihrem Arzt, dass es für sie schwierig sein würde, überhaupt mal ein Kind zu bekommen.
Doch nun wurde sie wider Erwarten schwanger. Ihre Beziehung bestand zu diesem Zeitpunkt erst wenige Monate, war aber schon von Misstrauen und sehr großen Zweifeln geprägt.
Wenn sie mit ihrem Traummann zusammen wäre und alles drum herum stimmen würde, könnte sie sich ein Kind vorstellen. Aber so am Ende noch als alleinerziehende Mutter – undenkbar!
Ihre Eltern würden zwar immer zu ihr stehen, doch trotzdem fühlte sie sich miserabel, so als wäre sie für alle und jeden eine riesige Last.
Insgeheim wünschte sie sich eine Fehlgeburt oder dass ihr Frauenarzt sagt, mit dem Kind stimme etwas nicht, es müsse weg. Ihre Verzweiflung nahm riesige Ausmaße an.
Natürlich hatte sie auch Angst davor, dass es nicht mehr klappt, wenn sie später vielleicht doch noch einmal ein Kind bekommen wolle.
Scheinbar sprach alles für eine Abtreibung – oder doch nicht?
Ich ermutigte Lisa: „Es ist doch wunderbar, Eltern zu haben, die immer für einen da sind. Das tun Eltern gern.“ Auch wenn die Vorstellung, eine alleinerziehende Mama zu sein, nicht ihr Wunsch gewesen sei, könne es in so einer schwierigen Beziehung auch gut sein, vorerst mit dem Kind allein zu leben. Auf ihre Bedenken zu den Folgen einer Abtreibung ging ich ausführlich ein und verwies sie darüber hinaus an ihren Arzt, der es auch von der medizinischen Seite noch einmal erklären könne, da sie Angst vor späterer Unfruchtbarkeit hatte. Zusätzlich bot ich ihr an, eine Beratung vor Ort für sie zu suchen.
Dann hörte ich länger nichts von ihr und befürchtete, dass sie den Weg der Abtreibung gewählt hatte.
Plötzlich wieder eine Mail von Lisa: Sie schrieb mir, dass sie sich für ihr Baby entschieden habe, obwohl der Vater des Kindes, von dem sie sich inzwischen getrennt habe, immer noch für eine Abtreibung sei. Jetzt spürte sie eine wahnsinnige Kraft in sich, die ihr dabei half, ihr Baby zu verteidigen und zu beschützen. Sie sagte ihm, dass sie den Weg allein gehen werde und keine Erwartungen an ihn habe.
Inzwischen freute sie sich sogar sehr auf die Geburt ihres Babys.
Zwar stand fest, dass sie ihre Selbstständigkeit aufgeben muss, wodurch sie zunächst kein Einkommen haben würde. Doch der Gedanke daran machte ihr keine Angst mehr. Ihr Baby war es ihr wert.
Mehr als 2 Jahre nach unserem Mailaustausch (2015) meldet sich Lisa wieder. Sie wollte einfach noch einmal danke sagen, dass ich ihre Worte gelesen und ihr geholfen hatte, ihre Gedanken zu sortieren. Sie bereute es so sehr, eine Abtreibung in Erwägung gezogen zu haben. Es machte sie unendlich traurig.
Ihr Sohn sei das Beste, was ihr in ihrem Leben passiert ist. Sie werde 3 Jahre zu Hause bleiben und jede Minute mit ihm auskosten.
Sogar der Vater ist inzwischen stolz auf seinen kleinen Paul und kümmert sich gut.
Lisa sagt: „Ich möchte meine Geschichte gern mit Frauen teilen und sie ermutigen. Mit der Kraft der Liebe kann man weit über sich hinauswachsen.“
(Lisa, September 2017)
Interview mit einer adoptierten Frau
Lebenshelfer: Wann und wie hast du von deiner Adoption erfahren?
Ich war fünf Jahre alt und liebte die Fernsehserie „Ich heirate eine Familie“. Ich durfte nicht viel fernsehen, aber diese Serie habe ich gemeinsam mit meinem (Adoptiv-)Vater sehen dürfen.
In irgendeiner Folge ging es darum, dass jemand ein fremdes Kind aufnehmen will. Ich verstand das nicht. Ich war ja erst fünf! Und so empörte ich mich ausgiebig darüber, warum Menschen fremde Kinder aufnehmen – das gehe doch nicht! „Dann sind die Mama und der Papa dieses Kindes ja allein. Und wo kommt überhaupt so ein Kind her???“ Wir sahen die Folge zu Ende, und anschließend nahm mein (Adoptiv-)Vater mich auf seinen Schoß und sagte:“ Weißt du, manche Mamas und Papas können ihre Kinder nicht so gut versorgen. Deshalb gibt es andere Mamas und Papas, die sich um diese Kinder kümmern und dafür sorgen, dass sie immer genug zu essen haben, dass sie immer etwas zum Anziehen haben und die sie genauso liebhaben, wie sie eigene Kinder liebhätten. Wir sind auch solche Eltern. Wir können keine leiblichen Kinder bekommen, aber wir wollten so gerne ein Kind haben, dass wir entschieden haben, dich zu uns zu holen und dich liebzuhaben. Laut meinem Vater habe ich daraufhin nur gesagt, dass er für mich mein Papa ist, weil ich ja keinen anderen kenne und weil ich ihn auch liebhabe. Damit war das Thema vorerst geklärt! :)
Lebenshelfer: Was hast du danach über deine leibliche Mutter gedacht?
Nun, anfangs habe ich gar nicht darüber nachgedacht, denn ich war ja noch sehr jung, als ich von der Adoption erfuhr. Für mich waren die Menschen meine Eltern, bei denen ich lebte. Auch Großeltern, Onkel und Tanten gehörten unweigerlich zu mir – dass es keine biologische Verbindung gab, war nicht wichtig.
Die Frage nach meinen leiblichen Eltern kam erst später, als mein Verstand begriff, dass da ja noch jemand sein muss; jemand anderes als meine Adoptiveltern, jemand, dessen Blut in meinen Adern fließt.
Die Frage nach meiner leiblichen Mutter und nach den Gründen für meine Adoption kam erst auf, als meine Adoptiveltern sich trennten. Ich fühlte mich verloren, hatte das Gefühl, plötzlich nirgendwo mehr hinzugehören – und im Hinblick auf die Adoption auch irgendwie unerwünscht zu sein.
Es gab Zeiten, da war ich wütend auf meine leibliche Mutter, weil sie mir das angetan hatte, als sie mich zur Adoption freigab. Ich zog in Betracht, dass es mir bei ihr hätte besser gehen können. Dass sie mich genauso gut hätte abtreiben können, fiel mir erst sehr viel später auf. Und in diesem Moment stellte ich fest, dass sie mir den größten Gefallen getan hatte, den eine Mutter ihrem Kind tun kann, wenn sie nicht in der Lage ist, sich selbst darum zu kümmern und es zu versorgen. Denn trotz aller Umstände in der Adoptivfamilie lebe ich – und dieses Leben ist so wertvoll! Heute bin ich meiner leiblichen Mutter zutiefst dankbar für dieses Leben. Sie hat sich für mich entschieden und nicht gegen mich! Sie ist über ihren eigenen Schatten gesprungen und hat mir damit ein Leben ermöglicht, in dem ich behütet war, gut versorgt sehr geliebt wurde. Was sie diese Entscheidung gekostet hat, vermag ich nicht nachzuvollziehen – aber es muss ihr unglaublich viel abverlangt haben. Heute habe ich einen sehr, sehr sporadischen Kontakt zu ihr. Sie weiß, dass ich keinen Groll mehr gegen sie hege und dass ich dankbar bin für dieses Leben, dass sie mir geschenkt hat – wirklich von Herzen dankbar!
Lebenshelfer: Wie betrachtest du dein Leben in deiner Adoptivfamilie mit dem Wissen, adoptiert zu sein?
Dieses Leben – auch wenn nicht alles glatt gelaufen ist – war und ist ein Segen. Meine Adoptiveltern nahmen mich an, als wäre ich ihr eigenes Kind. Mein (Adoptiv-)Vater war mein Held, wie das bei so vielen Töchtern ist – ich habe ihn abgöttisch geliebt. Ich hätte ihn mit meinem Leben verteidigt, wenn es notwendig gewesen wäre. Und ebenso konnte ich mich hundertprozentig auf ihn verlassen. Ich wusste, auch wenn er mal ärgerlich auf mich war – wenn es drauf ankommt, kämpft er für mich. Mit meiner (Adoptiv-)Mutter hatte ich nach der Scheidung eine Weile nichts mehr zu tun, aber auch von ihr weiß ich heute, dass sie nie etwas anderes als meine Mutter sein wollte. Trotz aller Umstände hatte ich eine gewisse Sicherheit in dieser Familie. Ich gehörte dort hin und ich fühlte mich auch wohl damit. Meine Adoptiveltern versuchten mir alles zu geben, was in ihrer Macht stand. Wir hatten genauso Streit und Auseinandersetzungen wie andere Familien und ebenso oft haben wir miteinander gelacht und Spaß miteinander und aneinander gehabt. Im Großen und Ganzen eine ganz normale Familie, nur ohne biologische Verbindung. Meine Adoptiveltern wurden zu meinen Ersatzeltern – und dennoch wusste ich, dass es da auch noch eine biologische Linie gibt. Und das war in Ordnung so.
Lebenshelfer: Was denkst du über das Thema Adoption?
Adoption ist etwas Gutes. Es ermöglicht Leben, wenn eigentlich kein „normales“ Leben möglich scheint. Adoption gibt Perspektive und Zukunft. Kinder wie ich, die adoptiert sind, haben eine Chance bekommen. Mütter, die – aus welchem Grund auch immer – ihr Kind zur Adoption freigeben, weil sie es selbst nicht aufziehen können, schaffen Leben und geben diese Chance. Sie sind Lebensspenderinnen, die ihr Herz nicht nur außerhalb ihres Körpers tragen, sondern einen Teil davon ziehen lassen, damit es etwas Besseres bekommen kann, als sie selbst ihm bieten können. Paare, die ein Kind adoptieren, sind Lebensretter, Möglichkeitenschaffer, Ersatzliebende! Alle drei Parteien sind sooo wertvoll, weil Leben sooo wertvoll ist!
An dieser Stelle möchte ich DANKE sagen für all die Menschen, die an meiner Adoption und meinem damit verbundenen Lebensweg beteiligt waren:
Danke an meine leibliche Mutter, die mich leben ließ. Die nicht bei sich aufhörte zu denken und zu handeln, sondern meine Möglichkeiten in Betracht zog, als sie mich zur Adoption freigab!
Danke an meine Adoptiveltern, die mich aufnahmen, als würde ich schon immer dazu gehören. Die mir ein Heim, ihr Herz und damit auch eine Identität schenkten. Die mit mir durch dick und dünn gegangen sind, mir so unendlich viel beigebracht haben, was mir heute hilft, den Alltag und das Leben zu bewältigen. Danke für jede Auseinandersetzung und jede Grenze, an der ich wachsen durfte. Danke für jede Ermutigung und jede starke Hand zum Festhalten! Danke für jede Krise, die wir überstanden haben und dass wir heute trotz aller Stürme immer noch eine Familie sind.
Kopf gegen Herz – oder Vernunft gegen Gefühle?
Ich hatte schon die Vermutung, dass der Test positiv war, und als ich dann den schwachen Strich gesehen habe, war meine erste Reaktion bereits Freude, aber auch Angst. Mein Freund war zunächst skeptisch: „Ach was, da sieht man ja fast nichts. Ich glaube das erst, wenn es ein Arzt bestätigt“. Obwohl ich den Drang hatte, darüber zu reden, schwieg mein Freund an diesem Tag das Thema tot. Ich hingegen malte mir schon aus, wie unser Kind wohl aussehen würde.
Als wir am Abend zu unseren Freunden fuhren, begannen wir im Auto dann doch, darüber zu reden. Er zählte alles auf, was gegen das Kind zu sprechen schien, obwohl ich eigentlich erwartet hatte, dass er sagt, wir würden es zusammen schaffen:
- Er wolle nochmal studieren (mein Einkommen somit als einziges Einkommen).
- Wir wohnen nicht zusammen, sondern beinahe eine Stunde auseinander und führen praktisch eine Fernbeziehung.
- Aufgrund meiner Magen-Darm-Probleme und meiner Phobie wäre die Pflege eines Babys nach seiner Einschätzung für mich körperlich und psychisch nicht möglich.
- Er möchte kein Kind, sich noch nicht einschränken.
Ich war total deprimiert und erwiderte: „Ja, dann kann man es ja auch „wegmachen“ lassen, wenn du es nicht willst, eine Option ist es ja“. Ich war einfach so enttäuscht, dass er sich gleich gegen die kleine Erbse stellte, die in mir wuchs. Meine Mutter, der ich davon erzählte, reagierte ebenfalls etwas geschockt, auch wenn sie versuchte, es sich nicht allzu sehr anmerken zu lassen. Ich sagte meiner Mutter, dass ich mit dem Gedanken spielte, einen Abbruch vornehmen zu lassen.
Nachdem ich am Wochenende mit starken Unterleibskrämpfen ins Krankenhaus kam, entstand folgender Eintrag in mein Tagebuch:
Freitag. 14.04.2017:
„Heute Nacht hatte ich solche Schmerzen wie noch nie und Angst, dass ich die Erbse verliere. Jetzt am Tag wünschte ich, dass ich nicht vor der Entscheidung stünde, ob ich das Baby behalte oder nicht. Alex* ist heute so mies drauf, dass er sich nur im Zimmer verkriecht (…). Meinen Urlaub hatte ich mir entspannter vorgestellt; jetzt sitze ich nur da und versuche mich zu entscheiden. Mit Kind ändert sich mein ganzes Leben: Ständig da sein für das Kind, der Körper verändert sich, kein Durch- oder Ausschlafen mehr, alles richtet sich nach dem Kind, keine freie Zeit mehr für mich selbst. Und so groß die Verantwortung und das ein Leben lang. Doch was kann der Embryo dafür, dass er ungeplant ist? Nichts! Eine Liebe zu einem Kind stelle ich mir toll vor. Wie alle das Baby mögen und sich freuen, wie es draußen spielt und die Welt entdeckt. Was, wenn ich es aber nicht hinbekomme wegen meiner Phobie? Was, wenn das Kind krank wird?! Was, wenn Alex mich verlässt oder ich ihn? Finde ich dann einen Mann, der mich auch mit Kind will?“
Zum Termin bei der Schwangerschaftsberatung begleitete mich mein Freund. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Beraterin auf seiner Seite, also für einen Abbruch, war. Meine psychische und körperliche Verfassung spräche für einen Abbruch, so seine Worte. Ich verstand nicht; ich war doch nicht todkrank und auch nicht verrückt. Klar ist eine Emetophobie (Angst vor dem Erbrechen) nicht gerade von Vorteil für eine Schwangerschaft oder ein Kind, aber zusammen könne man das doch schaffen. Ich konnte doch die kleine Erbse in mir nicht umbringen, die ich geschaffen hatte. Es waren nicht nur ein paar Zellen, sondern das „Zellhäufchen“ hatte bald Füße und Hände mit Zehen und Fingern, und das Herzchen würde schlagen.
Trotz meiner Gedanken für dieses kleine „Etwas“ in mir ließ ich mich von meinem Partner überreden, bei einem Arzt anzurufen, um einen Termin für die Abtreibung zu vereinbaren. Es gab Tage, da war ich mir sicher, es sei das Richtige, die Erbse nicht zu bekommen. Doch einen Tag vor dem Termin zur Abtreibung weinte ich schon nachts um das kleine Ungeborene in meinem Bauch und sprach mit ihm, dass es mir leidtue. Am Morgen rief ich in der Praxis an und sagte den Termin ab. Vorgeschoben hatte ich eine Erkältung, obwohl ich insgeheim wusste, dass eine Ausrede war.
Je weiter die Schwangerschaft fortschritt, desto mehr wusste ich, dass die Erbse in mir wie ein Mensch aussah – umso schlimmer der Gedanke, es umzubringen. Trotzdem dachte ich irgendwie, es sei das Richtige, weil so vieles dagegensprach, es zu behalten. Kopf gegen Herz… oder Vernunft gegen Gefühle?!
Auf Drängen meines Freundes ließ ich mir erneut einen Termin zur Abtreibung geben. Wieder und wieder sagte ich meinem flehenden Herzen, es sei das Richtige, es würde zu vieles gegen das Kind sprechen.
Noch ein Eintrag aus meinem Tagebuch ohne Datum:
„Will ich das Kind nur nicht, weil er es nicht will, oder tatsächlich, weil ich es selbst nicht möchte? Am liebsten würde ich es doch wegmachen lassen. Dann wäre alles wieder so wie vorher. Aber das stimmt eigentlich nicht… Nichts wird wieder so wie vorher. Alles geht kaputt, egal, was ich tue. Ich hätte es mir sparen können, zu ihm zu fahren, weil er nicht mit mir geredet hat und betrunken war. Ich versaue sein ganzes Leben, wenn ich es bekomme, sagt er. Er weiß so ja schon nicht, was er wirklich will…Ich kann etwas Lebendes, Wachsendes nicht einfach umbringen. (…) Würde ich mich freuen, wenn er nicht so dagegen wäre?“
Der zweite Termin für die Abtreibung war der spätestmögliche Zeitpunkt in dieser Praxis. Sonntags war ich alleine zu Hause. An diesem Abend entschied ich, die Erbse in mir zu bekommen und nicht zu dem Termin zu fahren. Ich sprach mit der Erbse in mir und sagte ihr, sie sei jetzt in Sicherheit, und ich würde alles tun, damit es ihr gut geht. Mein Partner rief mich betrunken an und sagte, ich würde ja auch Fleisch essen, und die Tiere würden genauso getötet, dann könnte ich das mit dem Baby ja wohl auch machen. Ich solle einfach hingehen und nicht daran denken, dass ich es umbringe. Er war so betrunken, dass er mich nur noch anschrie. Trotzdem blieb ich standhaft und habe mein kleines Erbsen-Mädchen behalten. Als ich den Abtreibungstermin absagte, fiel eine riesige Last von mir. Am gleichen Tag sah ich auf dem Ultraschallbild das erste Mal das Herzchen meiner Erbse schlagen.
Mein Ex-Partner konnte sich nie mit dem Gedanken eines Kindes anfreunden und hat sich irgendwann in der Schwangerschaft von mir getrennt. Ich bin nun eine alleinerziehende Mama mit einem wunderbaren Mädchen. Natürlich ist es nicht immer einfach, und ich komme gelegentlich an meine Grenzen, aber dieses kleine Mädchen und ich – wir sind Kämpferinnen. Ich würde sie nie wieder hergeben und bereue es nicht, sie behalten zu haben.
(Miriam (24) im Januar 2018)
*Anm.: Der Name von Miriams Ex-Partner wurde geändert.
Ein schneller Schritt mit ungeahnten Folgen
Mit 18 hatte ich einen Freund, der bei meinen Eltern nicht gern gesehen war. Nicht nur die Tatsache, dass er vorbestraft war, machte ihn bei ihnen unbeliebt. Ich hingegen nahm ihn so, wie er ist. Nach einigen Tagen der Beziehung kam es zum Geschlechtsverkehr. Da ich weder Pille, Implantat noch Spritze vertrug, benutzte er ein Kondom. Doch dieses platzte. Nach anfänglicher Wut auf ihn machte ich mir keine weiteren Gedanken und wartete auf meine Regelblutung.
Als ich zwei Tage über dem Termin war und mir jeden Morgen schlecht wurde, vertraute ich mich meiner Schulkameradin an. Locker und leicht beschloss ich auf ihren Rat hin, in die gegenüberliegende Apotheke zu gehen, um mir den billigsten Schwangerschaftstest zu kaufen. Ich ging auf die Toilette und machte den Test. Nachdem ich herauskam, setzte ich mich an den Tisch. Nach Minuten des Wartens traute ich meinen Augen nicht. Keine Ahnung, wer in diesem Moment schlimmer schaute, sie oder ich? SCHWANGER!
Jetzt wollte ich nur noch mit meiner Frauenärztin sprechen. Einen Tag später hatte ich einen Termin. Sie machte einen Ultraschall und gratulierte mir. „Wie geht es jetzt weiter?“ Ich war unter Schock und verstand nicht, was sie mir da gerade erzählen wollte.
Es war heftig, denn der Kindesvater war unzuverlässig, und ich hatte keine Ahnung, ob ich es meinen Eltern sagen soll. Mein Daddy ist einfach der Beste, aber dessen damalige zweite Frau ist alkoholabhängig. Ich lebte bei ihnen. Zu meiner Mutter und ihrem Partner habe ich seit Jahren keinen Kontakt mehr. Ich weihte einen guten Freund ein, der schneller als gedacht dafür sorgte, dass jeder (bis auf meine Eltern) wusste, was los ist. Über einen Messenger wurde ich dann von verschiedenen Personen gefragt, ob sie Patentante werden dürfen …
Damals dachte ich: „HALLO!? Ich habe gerade erst erfahren, dass ich schwanger bin. Mein Ex ist ein Arschloch und meine Stiefmutter trinkt. Wo soll ich hin? Wie soll ich meine Berufsfachschule beenden? Werde ich mit Kind eine Ausbildung finden und packen? Der Erzeuger ist ein Knasti gewesen!“ Ich fühlte mich einfach nur unverstanden und überrumpelt!!!
Zwei Tage später rief mich meine Stiefmutter zu sich in die Küche. Mein Herz schlug so schnell wie nie zuvor. Wusste sie, was Sache ist, ohne dass ich etwas gesagt hatte?“ Sie erzählte mir: „Biene, ich habe geträumt, dass du schwanger bist, und ich muss dir sagen, dass ich nicht hinter dir stehen könnte.“ Seit diesem Satz stand meine Entscheidung fest. Ich hatte niemanden und konnte das meinem Kind nicht zumuten! Mein Baby darf nicht leben, denn hergeben kann ich es nicht. Es ist ganz allein meins!
Kurze Zeit später hatte ich erneut einen Termin. Wieder wurde eine Ultraschalluntersuchung gemacht. Auf dem Bild war bloß ein winziger Punkt zu sehen. Diesmal musste ich meine Entscheidung kundgeben. Es wurden die weiteren Wege besprochen. Eine „Freundin“ begleitete mich zur Krankenkasse. Sie hatte selbst drei Kinder und bereits eine Abtreibung hinter sich.
In der Schule schauten mich alle so komisch an, dabei wusste keiner was davon. Eine der Schülerinnen war hochschwanger. Ihr Anblick machte mich fertig. Ich fing an zu weinen und ging vor die Tür. Mein Mathelehrer kam hinterher und sagte: „Sabine, du bist schwanger. Ich merke das, denn ich weiß, wie sich Mädels in deinem Alter in dieser Situation verhalten, meine Frau ist Gynäkologin“. Ich konnte nur nicken und ging nach Hause. Das war alles zu viel. Schon jetzt, wo mein Schatz in mir lebte.
In der Zwischenzeit lernte ich einen jungen Mann kennen, der mich so nahm, wie ich bin. Er wusste Bescheid und begleitete mich zu dem Termin bei Pro Familia, wo uns eine Dame mittleren Alters empfing. Wir wurden in einen Raum begleitet, in dem ich nun alles erklärt bekommen sollte. Ich wurde nach den Umständen gefragt und äußerte meine Bedenken. Sie schaute meinen Freund an und fragte ihn, ob er sicher sei, dass ich das wirklich wolle. Er bestätigte dies natürlich. Diese Frau erklärte mir nicht einmal, welche Hilfen ich hätte bekommen können. Sie erzählte mir sofort, wie mein Kind abgesaugt wird (natürlich total verharmlost) und ließ mich die Papiere für den Abtreibungstermin unterschreiben. Somit war alles geklärt.
Am Freitag vor der Abtreibung bekam ich einen Anruf von der Mutter des Erzeugers. Soweit hatte es sich also schon herumgesprochen. Sie versprach, keinem was davon zu sagen und verkündete, dass er wieder hinter „schwedischen Gardinen“ sitzt. Sie verabschiedete mich mit den Worten: „Ich wäre gerne Oma geworden, doch bei meinem Sohn kann ich verstehen, dass du dein Kind nicht austragen willst.“ Die Oma meines Kindes bestätigte mein Denken. Jetzt waren es nur noch drei Tage bis zu dem Termin der Abtreibung.
Am Samstag vor der Abtreibung bekam ich eine Blutung. Ob das der ganze Stress war?
Montagmorgen fuhren mein Freund und ich an den Ort, an dem mir mein Baby entfernt werden würde. Der Arzt rief mich auf, nachdem ich wieder Papiere unterschreiben musste. Er machte das letzte Ultraschallbild und meinte nur: „Es ist durch ihre Blutung eine absolute Risikoschwangerschaft und wahrscheinlich, dass Sie das Kind verlieren werden.“ Dann wurde ich in ein Zimmer gebracht, in dem ich mein Nachthemd anziehen musste. Sie holten mich und ich musste mich auf eine Liege legen. Meine Arme wurden fixiert und ich spürte, wie der Arzt mich im Intimbereich desinfizierte, während einer der anwesenden Frauen meinen Kopf streichelte. „Warum in Gottes Namen streichelt die meinen Kopf, bin ich ein Baby oder was?“ Ich erhielt eine Spritze und schlief sofort ein.
Als ich wieder wach wurde, rief man meinen Freund herbei. Ich umschloss ihn fest und fing an zu weinen. Nein, ich war nicht traurig, es war wie ein Stein, der auf meinem Herzen saß und mich bedrückte, und nun war er weg. Die Welt schien in Ordnung zu sein.
Auf der Toilette sah ich dann die Überreste der Desinfektion und die starke Blutung, die folgte. Ich hatte Schmerzen und wollte nur noch nach Hause. Dort legte ich mich ins Bett und behauptete, ich hätte Kopfschmerzen.
Am nächsten Tag ging ich trotz Krankschreibung zur Schule, damit niemandem etwas auffiel. Alles war in Ordnung, und ich genoss mein Leben Tag für Tag.
Doch eines Tages fuhr ich mit meiner Klasse zur Ausstellung „Körperwelten“. Dort kam das böse Erwachen. Nun stand ich das erste Mal vor einem Glas, in dem ein Kind in der 7. Schwangerschaftswoche eingelegt war. Es hätte meins sein können. Es hatte zwar noch einen bohnenförmigen Kopf und Hautlappen zwischen den Fingern und Zehen, doch ich konnte alles sehen. Ich fing an zu weinen und wurde von meiner Klassenkameradin nach draußen gebracht. Es war zu viel, denn jetzt fing ich an zu realisieren, was ich getan hatte!!! Der zweite Schlag ließ nicht lange auf sich warten. Eine Freundin, die zehn Tage nach mir schwanger wurde, hatte ihr Kind bekommen.
Einige Zeit später begann ich meine Ausbildung zur Krankenschwester. Ich fing an zu forschen, wann ein Kind wie weit entwickelt ist. Mein Kind hatte schon einen Herzschlag, fing gerade an zu hören, und auch das Hirn arbeitete schon. Es musste nur noch wachsen! Warum zum Teufel haben die Gynäkologen (und es waren ja insgesamt drei!) mir nichts gesagt?! Ich hätte nie abgetrieben! Es hat gelebt, und nur mir war das nicht bewusst.
Vier Jahre später beschäftigte mich der Kinderwunsch so sehr, dass ich vorher alles geklärt haben wollte. Ich beantragte die Papiere meiner Abtreibung.
Meinem Kind schrieb ich in einem Kondolenzbuch eines Onlinegrabes, denn dort ist der einzige Ort, an dem ich mit meinem Kind offen sprechen kann und meine Worte nicht vergehen: „Hey Baby, gestern habe ich einen Brief erhalten, in dem steht, dass ich die Möglichkeit habe, alle Unterlagen von deiner ,Geburt‘ zu bekommen. Bin viel am Nachdenken, ob ich das wirklich tun sollte. Ich würde das erste Mal nach 4 Jahren Bilder sehen, Bilder mit einem Punkt drauf. Ja, du warst der Punkt … Ich vermisse dich jeden Tag so unendlich doll! Oh Leonie, wenn ich dich zurückholen könnte, würde ich es tun. In Zukunft will deine Mama Sterbende begleiten und evtl. Beratung von Schwangeren lernen, die eine Abtreibung machen wollen … Sie hat es noch immer nicht verkraftet. Süße, bleib stark! Jetzt, wo ich weiß, wo ich dich finden kann, werde ich öfter mal reinschneien und Grüße dalassen … In ewiger LIEBE, deine Mama.
Leonies Vater bekam eine Kopie von dem Grab ins Gefängnis geschickt, obwohl er mir vorher drohte, dass was passieren würde, wenn ich Leonie nicht behalte. Heute trauert er auf seine Art. Er fragt sich, ob es nicht Schicksal war und wir es noch einmal versuchen sollten. Doch das will ich nicht.
Irgendwann werde ich Mutter sein und mein zweites Kind wird einen Namen erhalten, der an meine Leonie erinnert. Sie gehört dazu, und ich werde sie nie wieder hergeben, denn in meinem Herzen wird sie für immer sein!
Es sind nun neun Jahre vergangen, und ich habe viel erlebt. Ich bin Krankenschwester und Hospizhelferin (Sterbebegleiterin). Der Freund, der uns damals zur Abtreibung fuhr, ist sehr jung verstorben und passt jetzt bestimmt auf meinen Engel auf. Sterbende, die ich in der Ausbildung und auf der Krebsstation traf, verabschiedete ich mit den Worten: „Grüß meinen Engel, passe auf ihn auf. Sag ihr, dass ich sie liebe und nie vergesse. Erzähl ihr von meiner Reue und der Hoffnung, sie eines Tages in die Arme nehmen zu dürfen.“
Der Schmerz ist auch nach den vielen Jahren noch so intensiv, als sei es gestern gewesen. Ich habe keine Angst zu sterben, denn ich weiß, ich werde meine Tochter wiedersehen!
Meine Eltern wissen inzwischen davon, und mein Daddy und seine jetzige Frau leiden mit mir. Meine Mutter und ihr Freund machten mir Vorwürfe und fragten, warum ich mich nicht gemeldet hätte, sie hätten mir geholfen.
Ja, es ist wahr, ich habe die Einwilligung zum Tod meines Kindes gegeben, und ich kann es nicht widerrufen. Ich möchte … nein ich WILL mein Kind zurück!!! SOFORT!!!
Um mich herum kann keiner das empfinden, was ich empfinde, denn ich hatte keinen Spaß daran, ich habe meinen inneren Tod selbst bestimmt. Mit meiner Tochter ist auch ein Teil von mir gestorben, und das nur, weil ich es gut meinte und nie ahnte, dass mein Leben ohne Leonie viel schwerer werden würde als mit ihr an meiner Seite.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie bei mir ist, wenn es mir nicht gut geht. Manchmal singe ich für sie. In meiner Vitrine hat sie ihren Platz mit Spielzeug, Spieluhr und ihrem Bild. Auch ein unbeschrifteter Grabstein steht dort, der irgendwann ihren Namen und ihr Sterbedatum erhalten wird. Doch all das bringt sie nicht zurück.
Es ärgert mich, dass ich mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt habe, als ich in dieser Situation war.
Ich bin heute verheiratet und habe einen gesunden Jungen. Mein Ehemann versteht zwar nicht alles, aber steht hinter mir! Jetzt, wo das Personenstandgesetz geändert wird und auch Kinder unter 500 g eingetragen und bestattet werden dürfen (auch rückwirkend), werde ich alles tun, damit Leonie auch auf den Papieren mein erstes Kind wird! Unser Sohn Eric wird von Anfang an wissen, dass es Leonie gegeben hat und in Mamas Herz immer geben wird.
Meine Mutter hat ihren Freund geheiratet. Wir haben uns ausgesprochen und pflegen den Kontakt sehr! Heute sehe ich, dass ICH den Schritt hätte gehen müssen! Sie hätten mich NICHT ALLEIN gelassen und sind wundervolle Großeltern! Die Nichte meiner Oma wird dieses Jahr auch Mutter, und wenn es eine Tochter wird, soll sie Leonie heißen. Ich habe mich als Tante angeboten und hoffe, dass diese Leonie das Leben führen kann, das meine nie führen wird.
An alle, die dies gelesen haben:
Oft habe ich gedacht, dass ich Menschen um mich habe, die zu mir stehen. In 90 % der Fälle stand ich am Ende allein! Es schmerzt bis heute, wenn ich daran denke, dass es Realität ist! Alleine schafft man das nicht, denkt man. Aber könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich einen Menschen an meiner Seite haben, der immer zu mir stehen würde und ich zu ihm … MEINE TOCHTER!
Interview mit Frau S. über ihre Erfahrungen in einer anerkannten Konfliktberatungsstelle
Lebenshelfer: Wie hast du das Beratungsgespräche bei …. erlebt?
Ich empfand das Beratungsgespräch sehr einseitig. Die Beraterin nahm meinen Konflikt und meine derzeitigen Probleme gar nicht wahr und beriet mich ausschließlich hin zur Abtreibung. Das wollte ich so aber gar nicht. Ich bekam auch ohne Nachfragen den Schein. Auch das war nicht der Grund, warum ich die Beratungsstelle aufsuchte.
Lebenshelfer: Wurden dir Alternativen zur Abtreibung aufgezeigt? Wenn ja welche?
Nein. Mir wurden keine Alternativen zur Abtreibung aufgezeigt.
Lebenshelfer: Welche konkreten Hilfsangebote unterbreitete man dir?
Mir wurden keine möglichen Hilfsangebote aufgezeigt, wie es auch mit Kind gehen kann. Dies passierte erst beim zweiten Termin, auf meine konkrete Nachfrage nach „Wellcome“ z. B. Dann nannte mir die Beraterin Kontakte und Ansprechpartner.
Lebenshelfer: Wie gut verstanden fühltest du dich von der Beraterin? Wodurch?
Ich war sehr ambivalent in meinem Schwangerschaftskonflikt, da ich schon zwei Kinder habe (1 und 3 Jahre) und mich in einer angespannten, emotionalen Situation befand. Die Beraterin hat mir sehr ans Herz gelegt, es doch bei der bisherigen Familiengröße zu belassen, da ich ja jetzt schon komplett ausgelastet sei mit den zwei Kindern. Da wäre es doch für alle besser, wenn ich mich zu einer Abtreibung entschlösse.
Lebenshelfer: Wie ermutigt fühltest du dich von der Beraterin, es auch mit Kind schaffen zu können?
Die Beraterin hat mich überhaupt nicht ermutigt, mein Kind zu bekommen. Da ich mich, als ich von meiner dritten Schwangerschaft erfuhr, in einer emotional angespannten Situation (leichte Depression bzw. Angststörung) befand, hat die Beraterin mir ausdrücklich zu einer Abtreibung geraten. Sie sagte wörtlich: „Wenn Sie in Ihrer Vorgeschichte bereits psychisch labil waren, kann durch die Hormonumstellung in der Schwangerschaft eine psychische Krankheit richtig ausbrechen. Da wäre doch eine Abtreibung für alle Beteiligten besser. Und auch für das Kind wäre es besser, nicht auf der Welt zu sein, als wenn Sie dann einen psychischen Zusammenbruch bekämen.“ Dass eine Abtreibung genau so einen psychischen Zusammenbruch nach sich ziehen kann, davon hat sie kein Wort gesagt.
Lebenshelfer: Inwieweit wurdest du über den Entwicklungsstand deines Kindes aufgeklärt?
Darüber hat die Beraterin nicht gesprochen.
Lebenshelfer: Inwieweit ging die Beraterin auf mögliche körperliche und psychische Folgen einer Abtreibung für dich ein?
Über Folgen einer Abtreibung hat die Beraterin mich nicht informiert. Ich fragte die Beraterin: „Wie soll es mir denn gehen, wenn der Geburtsmonat meines Babys ist?“ Darauf antwortete sie mir: „Vielen Frauen macht das nichts aus und sie verkraften es gut.“ Für sie stand nur fest: Psychisch erkrankte Schwangere = Abtreibung. Dass sich diese Symptomatik durch eine Abtreibung noch verschlimmern könnte, dazu sagte sie kein Wort. Sie stellte eine Abtreibung als ideale Lösung für psychisch erkrankte Frauen dar. „Dann wäre alles einfacher.“
Lebenshelfer: Wurden die Methoden einer Abtreibung erklärt? Wie umfangreich hast du die Information hierüber empfunden?
Nach meiner direkten Frage, wie denn nun die Abtreibung erfolgen würde, hat sie mir mitgeteilt, dass in meinem Fall wohl die Absaugmethode angewendet werden würde. Ich war komplett geschockt darüber, dass hier das Kind zerstückelt wird. Auf meine geschockte Nachfrage: „Wird mein Kind dann tatsächlich zerstückelt?“, sagte die Beraterin nur: „Ja.“ Ich hatte den Eindruck, sie wollte über diese Frage nicht sprechen.
Lebenshelfer: Wie gut hast du dich im Anschluss an das Gespräch ermutigt gefühlt?
Ich hatte auf meinen Wunsch noch ein zweites Beratungsgespräch, da ich nach meinem ersten Gespräch immer noch sehr ambivalent war. Aber auch dieses hat mir nicht wirklich geholfen, da alle Fragen hin zum Kind nur von mir ausgingen.
Lebenshelfer: Wie lange hat das Gespräch gedauert?
Ich hatte zwei Gespräche mit einer gesamten Gesprächsdauer von ca. 2,5 Stunden.
Lebenshelfer: Was hättest du dir noch mehr gewünscht?
Ich hätte mir gewünscht, dass ich ernst genommen werde. Das bedeutet für mich, dass alle Fakten transparent dargestellt werden und nicht beschönigt wird. Z. B. sprach die Beraterin ausschließlich von einer „Schwangerschaftsunterbrechung“. Wenn es die Möglichkeit geben würde, die bereits bestehende Schwangerschaft zu unterbrechen und zu einem späteren, mir günstiger erscheinenden Zeitpunkt fortzusetzen, hätte ich dies gern getan. Aber jeder weiß, dass dies nicht möglich ist. Daher machte es mich eher wütend, wenn sie immer von Unterbrechung redete. Ich wäre gern umfassend aufgeklärt worden, um von beiden Seiten ein gutes Bild zu haben. Diese Beraterin schien in meinem Fall nur auf Abtreibung ausgerichtet zu sein. Sie hat nur auf mein explizites Nachhaken Fragen beantwortet, wie es auch mit Kind gehen könnte. Sie sprach ausschließlich von Abtreibung. Alle anderen Fragen/Themen wurden nur von mir ins Gespräch gebracht.
Lebenshelfer: Wie geht es dir jetzt mit deiner Entscheidung?
Ich bin heilfroh und total dankbar, dass ich mein Kind bekommen habe und mich nicht in dieser geschockten Situation zu so einer lebensverändernden Entscheidung drängen lassen habe. Ich bin so froh, dass sich in mir nach dem ersten Gespräch ein Trotz gemeldet hat, der mich nach weiterer Hilfe fragen lassen hat. Ich habe meine Pastorin angerufen und um einen schnellen Termin gebeten, weil ich Hilfe brauchte. Dieses intensive Gespräch hat mich ermutigt weiterzugehen und einen neuen positiven Blick auf das Baby, das in mir wächst, zu bekommen. Ich habe Zuversicht gewonnen, dass es möglich ist, es zu schaffen. Ich wusste aber auch, dass mein Mann voll hinter mir steht. Mein Sohn ist ein Geschenk, ein Wunder, und ich musste nach der Geburt erst einmal weinen, über meine Gedanken, die ich hatte, dieses Wunder zu verhindern. Er ist ein Geschenk! Ich bin erleichtert. Ich hatte das Gefühl, vor einer großen Klippe zu stehen und zu überlegen: „Springe ich runter oder nicht?“ Aber ich bin umgekehrt.
Lebenshelfer: Was kannst du anderen Frauen mitgeben?
Ich möchte andere Frauen ermutigen, sich für ihr Kind zu entscheiden. Ich bin bei weitem nicht immer eine gute Mutter. Aber wir wachsen jeden Tag mit unseren Kindern und unseren Aufgaben. Das ist es wert! Mein Wunsch ist, viele Frauen ermutigen zu können, dass sie vor dieser Klippe auch umkehren.
Dieses Interview stellt beispielhaft dar, wie unzureichend viele Beratungsgespräche in deutschen Konfliktberatungsstellen empfunden werden. Wichtig ist hierbei, dass kein Beratungsgespräch dem anderen gleicht. Wie immer, gibt es auch in diesem Bereich hilfreiche und weniger hilfreiche Beratungen. Daher soll dieses Interview nicht als Pauschalurteil verstanden werden. Leider wird jedoch immer wieder von einseitig empfundenen Gesprächen berichtet, sodass wir euch empfehlen, in einer solch hoch emotionalen Situation bei Bedarf immer eine zweite Meinung einzuholen.
Eine Entscheidung fürs Leben
Jedes Mal, wenn ich meine Kinder anschaue, wird mir klar, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass sie vor mir stehen. Keines von ihnen war jemals geplant.
Marley und Mary kamen unverhofft in meiner Schulzeit. In den Schwangerschaften mit beiden litt ich unter extremer Übelkeit, sodass ich auf künstliche Ernährung angewiesen war. Bei Mary bekam ich ein Portsystem; leider entwickelte sich eine Thrombose, sodass ich am Herzen operiert werden musste. In beiden Schwangerschaften hatte ich zudem massiven Nierenstau und Koliken. Deshalb folgten OPs an der Niere. Man teilte mir mit, dass diese Folgen für die Zukunft haben könnten. Doch ich habe mich für weitere OPs entschieden.
Bei Marley erhielt ich eine Not-OP an der Niere, als ich einen Herzstillstand hatte. Marley hat hiervon leider Folgen davongetragen: Er wurde aufgrund meines Nierenstaus und -versagens verfrüht in der 33+0 SSW geholt. Auch Mary kam bereits in der 33+0 SSW zur Welt. Der Kaiserschnitt hätte eigentlich 33+1 SSW erfolgen sollen. Doch an einem Sonntagmorgen hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Also wurde der Kaiserschnitt vorverlegt – Gott sei Dank! Die Gebärmutter drohte, vollständig zu zerreißen. Bei beiden Kindern lag ich von Anfang mit Wehenhemmern und heftigen Wehen an im Krankenhaus. Obwohl beide in der Schulzeit kamen, habe ich mein Abitur geschafft.
Nach dem Abitur folgten Jahre, in denen ich schwer krank war. Die Niere machte mir Probleme – mehrfache Sepsis (Blutvergiftung), Intensivstation, wieder Portsystem, insgesamt 40 OPs. Meine Ehe hat das sehr belastet. Wir trennten uns, nachdem ich wieder gegen eine Sepsis gekämpft hatte. Kurz nach einer Herz- und Nieren-OP hatte ich Sex mit einem Freund. Es war nur Spaß, Ablenkung. Leider klappte die Verhütung nicht, was ich eigentlich als nicht allzu schlimm einschätzte. Denn die massiven Verwachsungen im Bauchraum und der Tumor in der Gebärmutter hätten es eigentlich unmöglich machen sollen, schwanger zu werden.
Die „Pille danach“ durfte ich nicht nehmen, weil ich just eine Thrombose mit Embolie (Verstopfung eines Blutgefäßes) überlebt hatte. Als ich ein paar Wochen später mit Blutungen ins Krankenhaus kam, hätte ich es nicht für möglich gehalten: Ich war schwanger. Mein Mann und ich wollten unserer Beziehung gerade noch eine zweite Chance geben … Und nun das: Das Kind war nicht von ihm. Was sollte ich nur tun?
Doch ich wollte dem Wunder die Möglichkeit geben, zu leben. Die Ärzte machten mir keine Hoffnung, viele rieten aufgrund der Thrombosegefahr zur Abtreibung. Zudem wusste man nicht, ob der Tumor gut- oder bösartig war; die Niere war permanent gestaut und verursachte Koliken; Dauererbrechen mit künstlicher Ernährung; massive Blutungen mit Transfusionen; Wehen und die Angst, dass ich eine Gebärmutterruptur haben könnte …
Ab der 5. SSW blieb ich über Wochen im Krankenhaus. Es war hart – für alle! Ich merkte, dass mein Mann mich liebt, er unterstützte mich sehr. Meine Kinder besuchten ihre Mama im Krankenhaus. Wir verbrachten viel wertvolle Zeit zusammen. Ab 21+5 SSW war ich jeden Tag im Kreißsaal. Zu dieser Zeit wollten sie das Kind bereits holen. Ich hatte massive Blutungen und Wehen – Narbe unter 1 mm.
Es war eine Achterbahnfahrt. Doch an diesem Morgen des 3. Mai 2017 entschieden sich die Ärzte endgültig, Melody zu holen – es war die 30+0 SSW. Meine Plazenta löste sich …
Nach der Geburt blieb ich selbst noch sechs Wochen im Krankenhaus, Melody sogar acht Wochen. Der schönste Augenblick war, als ich alle meine Kinder zusammen um mich hatte. Jetzt, 15 Monate nach der Geburt, die teilweise sehr hart waren, bin ich unendlich dankbar, nie aufgegeben zu haben. Wir halten zusammen!
(Sunny, im August 2018)